Eine Steuerhinterziehung kann auch dadurch begangen werden, dass
die Steuererklärung nicht abgegeben wird, so dass das Finanzamt keine Kenntnis
von den Einkünften erlangt. Eine Kenntnis des Finanzamts ist auch dann zu
verneinen, wenn dem Finanzamt elektronische Daten von einem Dritten wie z.B.
dem Arbeitgeber übermittelt werden, diese Daten aber nicht automatisch der
Steuerakte des Steuerpflichtigen zugeordnet werden, sondern nur auf einem
Datenspeicher des Finanzamts mit der Steuernummer des Steuerpflichtigen
gespeichert werden und dort zum Abruf bereitstehen.
Hintergrund: Grundsätzlich
beträgt die Festsetzungsfrist vier Jahre. Sie verlängert sich im Fall einer
leichtfertigen Steuerverkürzung auf fünf Jahre und im Fall einer vorsätzlichen
Steuerverkürzung auf zehn Jahre.
Sachverhalt: Die Kläger sind
Eheleute. Bis einschließlich 2008 war nur der Ehemann Arbeitnehmer, so dass
keine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bestand (sog.
Antragsveranlagung). In den Streitjahren 2009 und 2010 war auch die Ehefrau
Arbeitnehmerin. Da die Ehefrau die Steuerklasse III und der Ehemann die
Steuerklasse V hatte, bestand nun eine Pflicht zur Abgabe einer
Steuererklärung; allerdings erfasste das Finanzamt die Kläger zu Unrecht
weiterhin als Fall einer Antragsveranlagung. Für 2009 und 2010 gaben die Kläger
keine Steuererklärungen ab; allerdings übermittelten die Arbeitgeber der Kläger
dem Finanzamt die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen. Die Bescheinigungen
wurden nicht in der Steuerakte der Kläger erfasst, sondern nur im
Datenverarbeitungsprogramm des Finanzamts unter der Steuernummer der Kläger
abrufbereit gespeichert. Im Jahr 2018 fiel dem Finanzamt bei einer
elektronischen Überprüfung auf, dass die Kläger zur Abgabe von
Steuererklärungen für die Jahre 2009 und 2010 verpflichtet gewesen wären. Es
erließ daher im Juni 2018 Schätzungsbescheide für beide Jahre. Hiergegen
wehrten sich die Kläger.
Entscheidung: Der
Bundesfinanzhof (BFH) hielt eine verlängerte Festsetzungsfrist wegen einer
Steuerverkürzung für denkbar und hat die Sache an das Finanzgericht (FG)
zurückverwiesen:
-
Die Festsetzungsfrist beginnt zwar grundsätzlich mit Ablauf
des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist. Besteht allerdings eine Pflicht
zur Abgabe der Steuererklärung, beginnt sie erst mit der Abgabe der
Steuererklärung, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Jahres, das auf das
Jahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist. -
Im Streitfall bestand eine Pflicht zur Abgabe der
Steuererklärung, so dass die Festsetzungsverjährung für 2009 mit Ablauf des
31.12.2012 und für 2010 mit Ablauf des 31.12.2013 begann und mit Ablauf des
31.12.2016 (für 2009) bzw. 31.12.2017 (für 2010)
endete. -
Allerdings kommt eine Verlängerung der Festsetzungsfrist von
vier Jahren auf fünf oder zehn Jahre in Betracht, falls die Kläger eine
Steuerverkürzung begangen haben sollten. Eine Steuerverkürzung kann durch
Unterlassen der Abgabe der Steuererklärung begangen werden, wenn hierdurch das
Finanzamt über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen wird. -
Im Streitfall wird die Steuerverkürzung nicht dadurch
ausgeschlossen, dass dem Finanzamt die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
von den Arbeitgebern übermittelt worden waren. Denn es kommt
entscheidend auf die Kenntnis derjenigen Finanzbeamten an, die für die
Bearbeitung der Steuererklärung zuständig sind. Bei ihnen ist
zwar eine Kenntnis des gesamten Inhalts der Papierakte bzw. elektronischen Akte
zu unterstellen. Dies gilt jedoch nicht für elektronische Daten, die nicht in
der Papierakte bzw. elektronischen Akte gespeichert bzw. (nach Ausdruck)
abgelegt werden, sondern nur allgemein auf einem Datenspeicher mit der
Steuernummer des Steuerpflichtigen gespeichert werden und dort abrufbar sind. -
Das FG muss daher nun prüfen, ob den Klägern Leichtfertigkeit
oder Vorsatz zu unterstellen ist, so dass eine leichtfertige Steuerverkürzung
mit einer fünfjährigen Verjährungsfrist oder eine vorsätzliche Steuerverkürzung
mit einer zehnjährigen Verjährungsfrist in Betracht kommt.
Hinweise: Bei einer
leichtfertigen Steuerverkürzung hätte sich die Verjährungsfrist für 2009 nur
bis zum 31.12.2018 verlängert, so dass die Klage insoweit Erfolg hätte. Da
selbst das Finanzamt nicht erkannt hat, dass seit 2009 die Voraussetzungen
einer Pflichtveranlagung vorlagen, wird das FG voraussichtlich eine
Leichtfertigkeit und damit erst recht einen Vorsatz verneinen.
Eine Einkommensteuerverkürzung durch Unterlassen ist vollendet,
wenn das Finanzamt die wesentlichen Veranlagungsarbeiten für das entsprechende
Jahr abgeschlossen hat. Dies war bezüglich des Veranlagungszeitraums für 2009
am 31.3.2011 der Fall, da das Finanzamt an diesem Tag die wesentlichen
Veranlagungsarbeiten für 2009 zu 95 % abgeschlossen hatte; hinsichtlich des
Veranlagungszeitraums 2010 hatte das Finanzamt am 31.3.2012 die wesentlichen
Veranlagungsarbeiten für 2010 abgeschlossen.
Quelle: BFH, Urteil vom 14.5.2025 – VI R 14/22; NWB
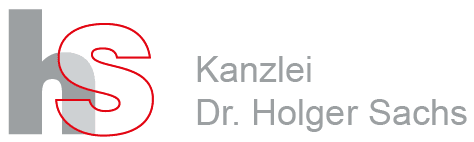
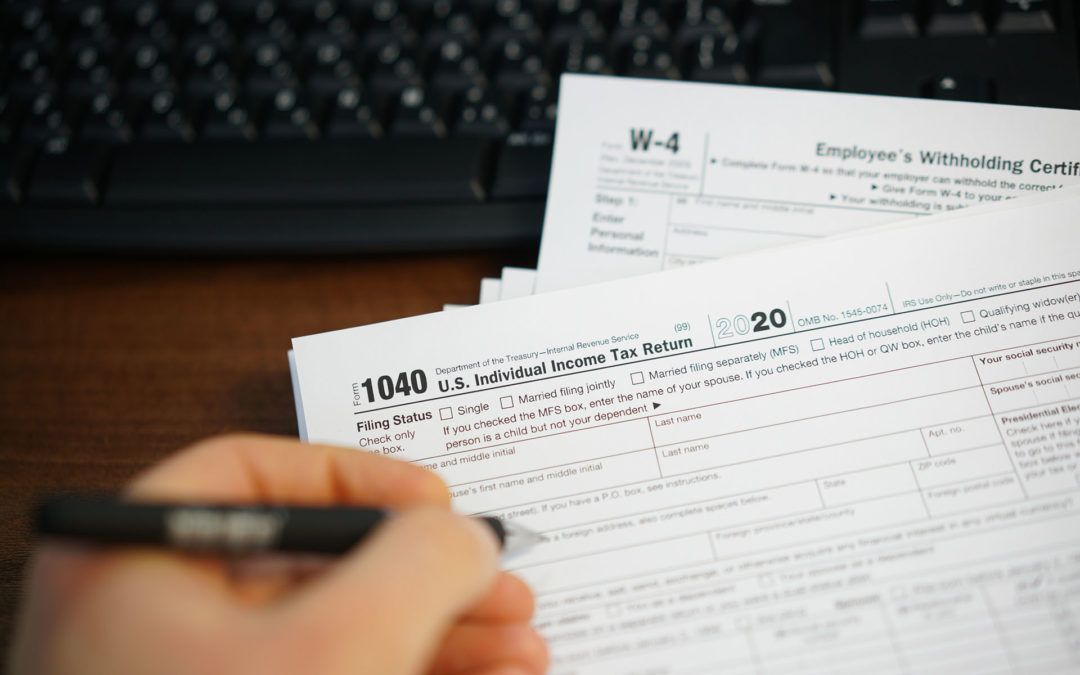
Neueste Kommentare